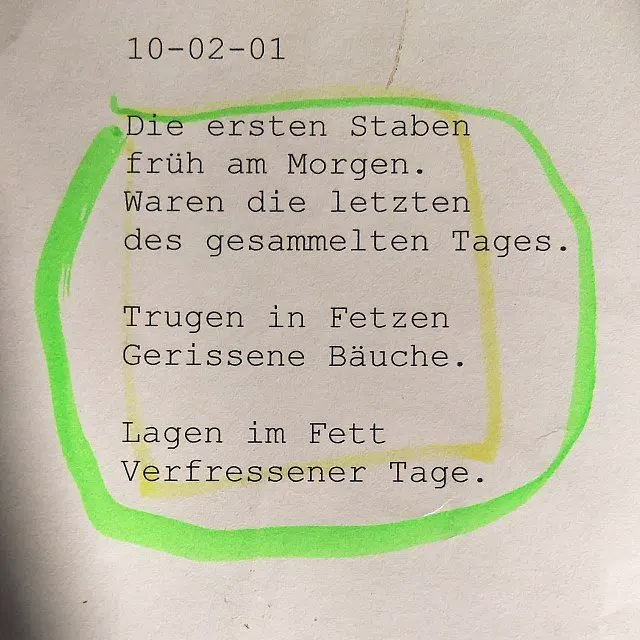Text
Prosa, Lyrik und Essay

In meinen Texten setze ich fort, was in Wortcollagen und Klangstücken beginnt: Sprache wird Material. Kurzgeschichten, Gedichte, Essays und Theatertexte kreisen um Alltagsszenen, Versprecher, Gedankenverirrungen – und um die komischen wie ernsten Momente dazwischen.
Inhaltsverzeichnis Text
Kurzgeschichten
Kleine Perle Glück
Dieser Reigen von Kurzgeschichten entstand zwischen 2003 und 2020. Zwei der Geschichten wurden in Anthologien veröffentlicht, drei auf Wettbewerben präsentiert und im Frühling 2019 sendete Deutschlandfunk-Kultur wöchentlich eine Episode als Autorenlesung,
"In den abgründigen Erzählungen mit dem Titel „Kleine Perle Glück“ nimmt uns Carsten Schneider mit in die Welt der Eigenheime, Carports und Gärten. Die Radiokunst von Schneider ist preisgekrönt und oft skurril – so wie diese Einblicke in ein Eheleben. Das Häuschen steht, im Garten sieht man die ersten Knospen an den Zweigen, und zwei Menschen suchen ihr Glück. Carsten Schneider erzählt Szenen aus dem Leben eines Ehepaars. Assoziativ, skurril und manchmal abseitig. Aus ihren Erlebnissen, ihren Tag- und Nachtträumen entsteht eine Welt voller Überraschungen, Hoffnungen und Abgründe. Und auch der im Keller lebende Geist des Großvaters scheint auf einige Fragen keine Antwort zu wissen." Tanja Runow, Programmheft des Deutschlandfunks
- Hier liegen vier Geschichten als Leseproben vor.
- 33 Geschichten als Hörbuch
- Einige Kurzgeschichten sind
zu hören auf der
Website vom Deutschlandfunk
Leseproben aus Kleine Perle Glück
Im Sommergarten – Ein Paar, ein Gartenfest, eine Schuldfrage und eine Nachbarin, die mit Pferden, Bienen und Fruchtbarkeitsritualen das Innenleben des Erzählers durcheinanderwirbelt.
Das Neue Hobby - Die Gattin pflegt ein neues Hobby. Der Mann will auch eins haben.
Der Meisterdieb – Ein Ölbild aus der Kindheit, ein Vater, der jede Familiengeste durchinszeniert, und ein Sohn, der seinen eigenen Titel erfindet.
Die Verborgene Kammer – Ein Hund, eine verschlossene Tür und die Frage: Was bewahren wir lieber?
Im Sommergarten
Hellblau und rosa weht der Morgenhimmel herbei und erklärt mir ungefragt, warum die Mütter ihre kleinen Kinder in eben diese Farben wickeln. Zufrieden entfalte ich die Zeitung. Meine Frau hat die schlimmsten Nachrichten bereits ausgeschnitten. Die Welt kann so schön sein. Durch die Zeitung sage ich zu meiner Frau:
„Ich brauche dich.“
Sie antwortet nicht. Sie liegt im Garten und weint. Ich schleiche durchs hohe Gras an sie heran wie ein kleiner Hund und schnappe die Wurst von ihrem Brot. Am Komposthaufen stellt sie mich zur Rede:
„Mein lieber Mann, was ist bloß in dich gefahren?“ Ich werfe mich zu Boden, rolle auf den Rücken und strampele mit den Beinen. Meine Frau schimpft:
„Deine ewige Verschlossenheit hat die neuen Nachbarn gestern tief beleidigt!“ – Gestern feierten wir ein Gartenfest, meine Frau, die neuen Nachbarn und ich.
„War ich wirklich verschlossen?“, frage ich treuen Blickes.
„Du hast den ganzen Abend nicht ein Wort gesagt!“
Ich knurre meine Frau an: „Man hat mich ja nichts gefragt!“
„Du hast auf deinem Stuhl gehockt wie ein stummes Stück Holz!“
„Die inneren Worte zählen ...“, entgegne ich trotzköpfig.
Jetzt braust meine Frau auf: „Du ziehst deine Schuhe an und entschuldigst dich bei den Nachbarn!“
„Ja, mache ich.“
Ich klopfe an die Nachbarstür. Die Nachbarsfrau freut sich. Ich lächele. Weiter fällt mir nichts ein. Mein Mut sackt in mir zusammen.
„Möchten Sie meinen Mann sprechen? Der sitzt schon lange bei den Fischen, er angelt im Gartenteich; sehen Sie, wie er in der Sonne schimmert?“ Die Nachbarin knufft mir neckisch in die Seite. Ich packe sie am Hals. Lachend windet sie sich los, bittet mich in die Küche und schenkt mir Kaffee ein. Sie kommt auf meine Kinder zu sprechen. Ich atme tief durch:
„Ja, die Kinder“, sage ich, „die Kinder, die Kinder …“
„Hätte ich Kinder“, säuselt sie, „säßen meine Söhne mit am See. Mein Mann lehrte sie, das Netz zu werfen, mit dem Wind zu sprechen und die Segel zu hissen. Ich stünde derweil mit den Töchtern in der Küche. Wir brühten Kaffee und erwarteten sehnsüchtig die schweren Schritte der Männer auf der Diele, wenn sie wiederkehren in nassen Stiefeln, einen Korb voller Fische auf dem Rücken und einen Strauß von Seerosen unter dem Arm.“
Die Nachbarin lehnt sich weit aus dem Küchenfenster und seufzt. Ich überlege, wie ich der lieben Frau helfen kann, und als es mir einfällt, will ich weglaufen. Sie aber hakt ihren Arm in meinen:
„Kommen Sie, Nachbar, ich zeige Ihnen den Sommergarten!“
Sie reißt mich mit sich:
„Riechen Sie die Pferde? Da drüben grast der Wallach, und daneben steht die Stute, sieht sie nicht trächtig aus? Hier vorn pflanze ich Gemüse, und dahinter sehen Sie die Bienenstöcke. Imkern Sie auch? Kennen Sie den wundervollen Schwänzeltanz der Bienen? Mein Mann zeigt Ihnen das beizeiten. Doch folgen wir nun diesem Kiesweg hinauf bis zum großen Ameisenhaufen. Dort gelangen wir an einen Scheideweg: rechts führt er in den Irrgarten meines Mannes, und zur Linken liegt mein Weingarten. Da sitze ich am liebsten im Schatten der Trauerweiden und träume von meinen Kindern. Ich liebe Kinder und mein Mann auch. Deswegen saß er sogar im Gefängnis. Wir adoptierten Zwillinge, aber die sind nie bei uns angekommen.“
Die Nachbarin schaut versunken zum See hinüber:
„Ich weiß nicht, wo mein Mann so lange steckt? Er versprach, heute noch Holz zu hacken für mein Geburtstagsfeuer am nächsten Sonntag. Sie sind ganz herzlich eingeladen! Und vergessen Sie Ihre Frau nicht, und ziehen Sie sich bitte etwas Indianisches an: Wir planen ein Fruchtbarkeitsritual!“
Ich stolpere über eine Gießkanne in ein Erdbeerbeet. Ich will nach Hause.
„Sie wollen schon gehen?“, fragt die Nachbarin, „darf ich Ihnen wenigstens ein Stück Bienenstich einpacken für die Kinder – oder einen Flamingo für die Frau? Nein? Dann bringe ich Sie jetzt zur Tür.“
Ich hüpfe nach Hause. An der Gartenpforte empfängt mich meine Frau:
„Na, hast du dich bei den netten Nachbarn entschuldigt?“
„Ja, habe ich – innerlich.“ Ich deute auf den Bauch meiner Frau und frage:
„Bist du bereit für ein Kind?“ Doch statt zu antworten, verschwindet sie schnurstracks in der Küche und schließt hinter sich ab.
Gedankenverloren steige ich in den Partykeller hinab und lege eine Patience. Mit jeder Karte erscheinen neue Gäste, trinken Erdbeerbowle, scherzen und verdrehen sich langsam die Köpfe. Verkleidete Kinder huschen uns durch die Beine. Die Nachbarin tanzt mit ihrer Stute, und in der Bowle steht ein rosa Flamingo. Mit der letzten Karte verschwinden die Besucher abschiedslos. Alles ist wie zuvor, nur eine halb ausgesogene Frucht liegt noch auf dem Couchtisch. Mit Weinbrand spüle ich sie herunter, nehme ein Photoalbum aus dem Schrank und betrachte meine Kindheit. Ich sehe den Großvater. Ich lehne den Großvater zurück in den Korbsessel und lausche seinen Geschichten; sie halten die Vergangenheit am Leben. Ich türme einen babylonischen Papierstapel auf den Tisch und sehe den Großvater nicht mehr. Ich höre ihm zu, aber vergesse zu schreiben. „Morgen“, sage ich mir; und morgen ist der Großvater tot. Mein Blatt ist leer.
Ich weine:
„Schatz, ich habe Seife im Auge, komm bitte schnell!“ Wenn ich so jämmerlich rufe, kommt meine Frau stets gelaufen. Sie findet es lächerlich, aber sie kommt. Ich schmiege mich an ihren Hals und schluchze:
„Der Großvater saß wieder im Sessel!“ Sie streichelt mir die Wange. Ich sei ein erwachsener Mann, sagt sie, und sie frage sich, wie ich es bis hierher geschafft habe? Und sie flüstert in mein Ohr:
„Verbrenne den alten Sessel!“ Ich stutze. Ich verstehe zu wenig von meiner Frau. Sie geht in den Garten und schaukelt. Sie schaukelt über Stunden hinweg. Ich beäuge sie durch die Kellerluke. Nur selten springt sie ab, beugt sich zu Boden, pflückt ein trockenes Blatt aus den Beeten und schaukelt dann versonnen weiter. Auf den Höhepunkten ihrer Schwungkurve blickt sie zu den Nachbarn hinüber. Ich rufe meiner Frau ein Kompliment zu:
„Du bist heute unsagbar schön!“ Keine Antwort. Ich rufe erneut:
„Dein Pferdeschwanz flattert im Wind wie ein … ein …“ Mir fällt nur ein Pferdeschwanz ein.
Meine Frau entdeckt mich. Sie schwingt sich von der Schaukel und schüttelt den Kopf. Sie hört nicht auf, den Kopf zu schütteln. Sie steigt auf die Wippe und wartet. Worauf wartet sie? Ich denke nach: Ist mir in den letzten Wochen irgend etwas an meiner Frau aufgefallen? Nein, sie hat sich nicht verändert, ich habe sie nicht verändert, und wir haben uns nicht verändert. Sie muss schwanger sein, tiefschwanger! Ich eile in den Garten, kniee nieder und küsse den Bauch meiner Frau.
Sie stupst mich von sich, glättet ihren Rock, und schmollmundig sagt sie:
„Du weißt, daß wir keine Kinder haben wollen.“ Mich durchzuckt eine Idee. Ich klettere auf den Apfelbaum und linse über den Gartenzaun. Die Nachbarn voltigieren gerade. Die Frau trägt ein silbernes Tutu und spreizt sich auf dem Rücken des Pferdes. Ihr Mann hält gelassen die lange Leine. Ich rufe über den Zaun:
„Hallo! Nachbarn! Wir würden gerne mitreiten! Es geht aber nicht! Denn wir kümmern uns den ganzen Tag um unsere Kinder!“ Die Nachbarin reißt ihren Rappen herum, und ihr Mann hält inne. Die ganze Welt kommt langsam auf mich zu. Ich wende mich zur Gartenlaube und rufe:
„Kinder! – kommt und guckt die Nachbarn an!“ Die Laube steht still und schweigt. Ich laufe in die Laube und rede lautstark mit den Gartenstuhlpolstern. Rasch greife ich einen Zeichenblock, kritzele ein paar Striche aufs Papier und flitze zurück zum Nachbarzaun.
„Schauen Sie, liebe Frau Nachbarin, das haben die Kinder für Sie gemalt! Da sehen Sie die Kleinen auf dem Spielplatz, dahinter die Sonne und den sterbenden Großvater!“ – Ich frage mich, wie der Großvater aufs Papier gekommen ist? – Meine Frau wird so rot wie die untergehende Sonne. Die Nachbarin blickt hoch zu Ross auf mich herab und reitet in den Abendhimmel hinaus.
Der Sonntag beginnt pünktlich. Zum Indianergeburtstag möchte ich der Nachbarin ein neues Bild malen mit dem Titel Die Kinder im Apfelbaum. Doch der Baum sprengt den Rahmen meiner malerischen Möglichkeiten. Ich beschließe, den Apfelbaum entsprechend zu stutzen, greife einen weit herabhängenden Ast und lege die Laubsäge an. Meine Frau hebt die Hände gen Himmel:
„Der Baum hat in diesem Jahr noch keine Früchte getragen!“
Sie stellt sich schützend vor den Apfelbaum. Ich beginne, den Birnbaum zu beschneiden. Meine Frau ruft die Nachbarin zu Hilfe. Die Nachbarin bewacht den Apfelbaum, meine Frau umarmt den Birnbaum. Ohne groß darüber nachzudenken, richte ich den Rasensprenger gegen die Frauen an den Bäumen. Die quietschnasse Nachbarin brüllt ihren Gatten herbei und schreit mich an; ich verstehe kein Wort, es geht wohl um das Wasser. Der Gatte dreht mir den Arm auf den Rücken und bindet mich an den Birnbaum. Er trägt bereits Kriegsbemalung, zückt sein Fischmesser und bietet meiner Frau an, mir die Zunge aus dem Hals zu schneiden. Meine Frau sagt, das würde nichts ändern, lacht und stellt das Wasser ab. Sie umarmt die Bäume, küßt die Nachbarin und verspricht dem Nachbargatten die knackigsten Äpfel vom Baum. Dann sägen sie gemeinsam singend eine Lücke in den Gartenzaun, klettern hindurch und tanzen zu dritt von dannen.
Als ich endlich meine Fesseln zerkaut habe, ist die Nacht vollends über mich eingebrochen. Dumpfe Trommelschläge dröhnen aus Nachbars Garten, Gänse schnattern, Eulen heulen, Pferde wiehern – oder höre ich schon die Fruchtbarkeitsindianer? Leise steige ich in Nachbars Garten. Schatten tanzen um Feuer, spitze Schreie erfüllen die Nacht. Ich pirsche bis auf wenige Schritte heran, dann stolpere ich wieder über die vermaledeite Gießkanne. Die Trommeln verstummen; bin ich entdeckt? Ich presse mein Gesicht ins Erdbeerbeet. Als ich aufblicke, zieht der Indianerstamm Fackeln schwenkend den Kiesweg hinauf und versammelt sich johlend beim großen Ameisenhaufen. Eine Squaw zupft ihren Lendenschurz beiseite, entblößt den Leib und setzt sich mit blankem Hintern auf den Ameisenhaufen.
„Fruchtbar, fruchtbar, fruchtbar …“, singen die Indianer im Chor. Plötzlich quiekt die sitzende Squaw, springt auf die Beine und rennt blitzartig in Richtung des Teiches davon. So geht es reihum, bis alle Frauen im Teich hocken. Die Krieger aber stecken den Ameisenhaufen in Brand. Die Ameisen werden von der Hitze in die Luft geschleudert und verglühen im Nachthimmel. Die Männer tanzen zu den Bienenstöcken und singen:
„Fruchtbar, fruchtbar, fruchtbar ...“
Ich verlasse mein Versteck, trete die letzten Ameisen aus und gehe nach Hause, während in Nachbars Garten der wunderbare Schwänzeltanz der Bienen beginnt.
Bei Sonnenaufgang schleicht meine Frau ins Schlafzimmer. Sie duftet nach Feuer und Wasser und wünscht sich ein Kind. Ich wünsche es ihr auch, von ganzem Herzen. Sie seufzt:
„Mein lieber Mann, du wirst es im Leben immer schwer haben.“
Ich frage mich, wo ich es sonst schwer haben solle, und ich seufze genauso.
Den Rest des Sommers verbringen wir im Garten; wir wippen und warten, wippen und warten, wippen und warten …
Das Neue Hobby
Das neue Hobby
Meine Frau hat sich ein neues Hobby zugelegt. Sie will aber partout nicht verraten, welches: Ich würde es früh genug erfahren. Ich will auch ein neues Hobby! Dazu besuche ich das Hobby-Fachgeschäft im Neubaugebiet und lasse mich vom aufdringlichen Fachverkäufer eindringlich beraten.
„Soll es ein sinnvolles Hobby sein?“ fragt er und wirbelt um mich herum, und er macht dabei Zaubertricks mit Würstchen und Kartoffelsalat. Vollmundig sagt er:
„Also, mein Herr, ich denke, ein schönes Hobby für Sie wär, jeden Samstag auf dem Marktplatz eine Schießbude zu betreiben!“
„Ja, schon schön ...“, stochere ich in meinen Gedanken und suche den Grund: „Ich glaube eher an ein konventionelles Hobby, vielleicht was mit Bastelschere und Stanniolpapier?“
„Ooooooo“, staunt der Verkäufer, und ihm blubbern Silberblasen aus dem Hinterkopf:
„Unsere Bastelwelt ist riesengroß! Kommen Sie mal bitte mal bitte mal mit mir mit mir mit.“
Hinter der Hobbylobby öffnet er die Tür zum Bastelkeller: da sitzen sie und basteln: der Herr Bürgermeister nebst Gattin und Tochter, der Mann von der Frau vom Eiscafé, zwei Schulknaben und hinten in der hintersten Bastelecke ein sabbernder Greis aus einem Gruselfilm, den ich als Kind schon mal sah. Es ging um eine Irrenanstalt am Rande des Waldsees. Daran war ein Internat angeschlossen. Und jeden Samstag gingen sie rudern. Doch knapp bevor meine Erinnerung mich verängstigt, sage ich:
„Ich möchte ein ganz einfaches Hobby! Vielleicht Laub sägen oder Puzzle puzzlen!?“
Der Fachverkäufer wird schlagartig ernst und seine Frisur fällt zu Boden:
„Brrr, mein Herr, da haben wir einen Puzzleengpass ...!“
„Ja, na gut, … aber, wie gesagt: vielleicht die Bastelschere?“
„Herzjesu, da müssen Sie morgen wiederkommen!“
Ich gehe ohne Hobby nach Hause. Daheim finde ich meine liebe Frau auf dem Dachboden. Ich steige zu ihr, stolpere, es blitzt fürchterlich, ich falle … in einen Haken, meine Hand schreit laut. Da ist noch jemand, ein Mann. Er trägt einen schwarzen Schleier. Meine Frau beunruhigt mich:
„Wir machen hier Photos!“, liebsäuselt sie.
„Professionelle!“, ergänzt der junge Schleiermann.
„Das professionelle Photoportrait – Mein neues Hobby!“ strahlt meine Frau und treibt mich an, rasch die Fleischwunde der Hand auszuwaschen und kräftig zu jodieren.
Später im gemeinsamen Wohnzimmer präsentiert der junge Mann die fertigen Hobbyphotos meiner Frau. Alles sieht wahnsinnig professionell aus, sagt er. Ich glaube ihm und finde das neue Hobby meiner Frau sagenhaft schön. Es hat so was ... professionelles. So eins brauch ich auch. Sie aber sagt:
„Immer machst du alles nach! Du musst eigene Ideen entwickeln, nicht meine!“
Also trabe ich am nächsten Tag zurück ins Bastelzentrum, die schummrige Sabberecke ist noch frei, und ich will den ganzen Tag lang sabbern. Doch der Verkäufer legt mir ein Zauberbuch vor: Kaum schlage ich es auf, bin ich wieder Zuhaus.
Im Hintergarten liegt meine Frau unter dem elektrischen Rasenmäher. Ich schüttle bewundernd das Haupt, gehe ins Haus, rücke mich ins rechte Licht und lese. Ja, ich lese! Das soll jetzt mein Hobby sein – Ich lese in allen Büchern aber nur die As. Ich beginne mit den Märchen der Brüder Grimm. Und tatsächlich erscheinen sie in einem völlig neuen Licht, besonders das Rotkäppchen, da heißt es: „…ä… … ...a... …a… ...... …ä…, …a… …a… …a… ..., a…a…, “
Der Meisterdieb
Ich möge ihr bitte einen großen Sack frischer Blumenerde in den Rosengarten bringen, es sei dringend, ruft meine Frau:
„Aber nicht die billige, nicht die mit den toten Ameisenklumpen, die nicht!“
Ich durchkrame die Laube, es scheppert, klappert, klingt. Da stoße ich auf das olle Ölbild! Dieses Ölbild hat mein Vater mir zum zehnten Geburtstag geschenkt. Es zeigt einen spiddeldürren, weinenden Jungen, barfüßig, gebeugt, geknickt, in der Hand eine Leine, an der Leine ein rotes Spielzeugsegelboot; das zieht er durch den staubigen Sommersand. Mit dem Bild unterm Arm laufe ich zu meiner Frau:
„Schau, liebe Frau! Das Gemälde! Ein Geburtstagsgeschenk meines Vaters!“ Es war nämlich so: Als ich am Morgen aus dem Kinderzimmer tapse, ins Wohnzimmer zu flitzen, um Kuchen und Geschenke zu sehen, knalle ich gegen das Stehpult meines Vaters. Es steht genau vor meiner Kinderzimmertür, ich komme gar nicht durch - und dahinter, zehn Meter hoch, mein Vater. Mutter kniet seitwärts hinten in der dunklen Flucht des Flures und winkt verschüchtert herüber. Vater hebt an zu einer kleinen Rede – ich kann sie heute noch wiedergeben, weil mir Jahre später sein Redemanuskript in die Hände fiel. Ein blaues, kleinkariertes Buch, darin sämtliche Gesprächsvorbereitungen meines Vaters. Er hat sogar die Familienspielabende genauestens vorbereitet: Rommé-Witze, Mikado-Sprüche, Schach-Anekdoten. Und selbst die einsamen Spaziergänge mit meiner Mutter waren im Vorfeld fein durchformuliert.
Heute, zu meinem zehnten Geburtstag thront der Vater also vor der Kinderzimmertür:
„Einen herzlichen Glückwunsch, dir, meinem eingeborenen Sohn. Dies ist ein Freudentag für deine Eltern, weil du nun kein Kind mehr bist. Denn wisse: Du warst immer ein anstrengendes Kind, von Geburt an, besonders für deine Mutter. Doch genug davon, denn an diesem Ehrentag, wollen wir Altvorderen der Phantasie ein Törtchen backen. Drum sage, mein Sohn: Was willst du werden, wenn du groß bist? … sag schon … frei von der Leber weg! Kannst alles sagen … keiner tut dir was ...“
Da stehe ich und friere erbärmlich. Aus dem Flurschatten winkt Mama. Eigentlich muss ich zum Klo, doch stattdessen weine ich.
„Jetzt hat er in die Hosen gemacht! Am Geburtstag!“ Der Vater schüttelt sich. Wenn ich jetzt still bleibe, muss ich sterben, das weiß ich; drum nehme ich allen Mut zusammen und sage:
„Vater, o Vater, ich will ein Meisterdieb werden!“
„Hmh“, räuspert sich der alte Mann, „ein Ansatz – darauf kann man aufbauen! So, nächstes Thema: Wir erwarten dich in fünf Minuten getrocknet und gebleicht am Geburtstagstisch. Du bekommst ein ganz besonderes Geschenk. Beim Auspacken wirst du etwas Schönes singen. Und jetzt ab ins Bad, du kleiner Meisterdieb!“ Da flitze ich – husch! – ins Badezimmer. Mein Vater hat mich „Kleiner Meisterdieb“ genannt! Das ließ mein Kinderherz vor Glück fast explodieren.
Unten, auf dem Geburtstagstisch, stand der Kuchen. Mutter hatte ihn gebacken, und er war so trocken, daß er Feuer fing, als ich die Kerzen ausblies. Dann bekam ich das Ölbild geschenkt, genau dieses Bild mit dem Spiddelkind und dem kaputtenen Spielzeugschiff an der Lotterleine. Es war mein erstes Bild. Ich staunte:
„Vater, sag, wer ist der Junge? Was mache ich denn mit seinem Bild? Das ist doch sein Bild! Wer ist denn das? Oder bin ich das, oder bist du das?“ Die Antwort blieb mir versagt. Der Blick des Vaters zwang mich zu stiller Einfalt. Ich sang nochmal mein Geburtstagslied, die Eltern hatten sich bereits zurück ins Sonntagsbett gelegt, nachmittags kamen Nachbarkinder zum Spielen, aber meistens gewann der Vater, auch beim Topfschlagen und Schokoladenwegessen.
Das war der zehnte Geburtstag, und schon damals, noch am selben Tag, bekam ich ein bisschen Angst vor dem elften … Am elften Geburtstag fuhren die Eltern in ihren wohlverdienten Skiurlaub, ich war allein zu Haus, deshalb ging es.
Jetzt halte ich mir und meiner Frau das Gemälde vors Gesicht.
„Tja, was mache ich nun mit dem Bild?“ frage ich, „soll ich es am Strick hinter mir herziehen, so wie der Junge sein Segelboot?“
Und wie ich das Bild drehe und wende und zum ersten Mal die widmenden Worte meines Vaters lese, fange ich an zu zittern. Doch meine liebe Frau hält mich ganz fest fest, bis der Abend kommt, und das Bild verschwindet.
Die Verborgene Kammer
Als ich am Morgen erwache, sind alle meine Träume zu Ende. In Form einer Hundezunge leckt die Realität mir durchs Gesicht. Zuerst denke ich blinzelnd, es wäre meine Frau, oder der Waschlappen einer Krankenschwester. Aber es ist ein Hund, hechelnd lächelnd und mit vielen Haaren vor den Augen. Wir haben gar keinen Hund.
„Wir sollen auf ihn aufpassen“, sagt meine Frau, „er gehorcht den Nachbarn vom Ende der Straße. Die sind im Urlaub und wir nicht. Also, gaben sie heute früh den Hund hier ab.“
„Aha“, nicke ich nichtssagend. Der Hund freut sich über mich. Wir gehen in den Garten und ich werfe Stöckchen. Er sitzt neben mir und guckt zu. Ich sage:
„Wo ist die Wurst? Na? Wo ist die Wurst?“ Aber der Hund weiß es nicht.
Von drinnen ruft meine Frau. Meine Frau hat im Hause eine verborgene Kammer entdeckt. Sie getraut sich nicht, diese zu öffnen. Stattdessen flitzt sie sofort zu mir, ganz nah, und ich lege die Arme des Ritters um sie. Der Hund guckt zu. Sie flüstert:
„Glaub mir, Schatz, eine schmale Klinke, klein, vielleicht Messing, wahrscheinlich aus Eisen: ich konnte sie nicht drücken, ich konnte nicht …“
Sie blickt mich rehkitzig an. Ich weiß schon, was jetzt kommt: Ich soll die Tür öffnen. Ich soll da reingucken, in die Kammer, und ich soll da reingehen in die Kammer! Aber sie sagt ganz was anderes:
„Maure sie zu. Mache sie dicht. Verschließe die Kammer. Für immer!“
„Ja, klar, mach ich“, sage ich, „aber sag einmal: woher weißt du, daß eine Kammer hinter der Türe liegt, da du die Türe doch gar nicht geöffnet hast?“
Sie blickt mich an wie einen Gott. Und dann erzählt sie mir die bösesten Beispiele in denen hinter knarzigen Türen bitterböse Kammern lagen. Ich hingegen vermute einen Schatz, einen Welfenschatz, leuchtende Smaragde, güldene Broschen, einen Shawl aus Persien, einen Schatz eben. Aber meine Frau besteht darauf, daß ich die Tür zumaure. Der Hund bleibt neutral.
Ich steige hinab in den Keller. Mein Großvater schaut mir beim Zumauern zu. Er verstehe mich nicht, sagt er: er hätte reingeguckt, sagt er.
„Wollte ich ja auch“, stimme ich ein, „aber was soll ich machen? Für das Hausinnere ist meine Frau zuständig. Meine Verantwortung liegt draußen.“
„Ja, ja“, nickt der Großvater, „ich hätte sie trotzdem aufgemacht.“
„Ja! Hätte ich ja auch!“, wiederhole ich mich, und wir beginnen, uns im Kreise zu drehen, bis es dem Hunde ganz schwindelig zumute wird.
Doch das ist eine andere Geschichte ...
und die wird ein andermal erzählt!
Gedichte
Elefantenträne
Elefanten können weinen.
Punkt.
Dabei sollte man doch meinen,
Komma her du!
Weinen können nur die Kleinen,
Komma her du!
Doch Elefanten können weinen.
Punkt.
Traute und Jens
Als Jens sich nicht traute
Traute zu trauen
und Zutrauen
zum Traum verkam,
war Jens es,
der sich schlecht benahm,
als er Traute
fest vertaute
und im Kofferraum
verstaute
und beiden so
das Glücke nahm.
Der Täter
Durchs Gebüsch
Späht er,
Der Täter.
Da war er
Noch nicht
Der Täter.
Erst später
tat der Täter
tete-à-tete
die Tat.
Danach,
Nach der Tat,
War der Tattäter
In der Tat
Der Täter.
Und später
späht er,
der Täter,
der die Tat tat,
zurück ins Gebüsch
Noch später
Geht er,
Das war
viel später.
Und dann kaufte ich
Und dann kaufte ich
das Buch des Philosophen
der da meint
Scheitern sei schöner
als jeder Gewinnst
Was muß der sich
geärgert haben
als er abends erfuhr
sein Buch wird verlegt
Wort zu Wörtern
Die Wörter
ordnen sich
durch mich
geht es
nicht
.
Katzensonne
Am sonnigen Nachmittag,
wenn die Sonne mich mag,
spring' ich hinaus in den Garten,
wo die Katzen auf mich warten.
Wir rollen durch die Sonne,
wir rollen durchs Gras,
die Katzen spielen mit der Wolle,
und das Gras kitzelt in der Nase.
Ich setz' mich unterm Baum aufrecht hin,
und denk: wie wär's wenn Leute auf mich schießen?
Wenn mir der Bauch wehtut,
und die Kugel geht nicht raus?
Doch da schnurren die Katzen.
Wir rollen durch die Sonne,
wir rollen durch das Gras,
die Katzen spielen mit der Wolle,
und das Gras kitzelt in der Nase.
Auf dem Rücken meines Traumes
Auf dem Rücken eines Traumes
Ritt ich gestern abend aus.
Ich ritt zuerst nur durch den Flur,
Dann Wiese, Wald, ... naja - Natur!
Und am Fuße eines Baumes
Stockte plötz mein tumbes Tier.
"Weiter, weiter", schreit der Reiter.
"Nö", mault der Traum, "wir bleiben hier".
Wieso denne dat denn?
Komisch Traum,
Bleibt stehen vorm Baum.
Och, Menno, hoppla und Moment:
Das ist ja ...
Das ist ja ... eben jene welche Buche,
Nach der ich schon sooo lange ... schaue
Auf das ich mir ein Häuschen baue.
Denn wie das geht, las ich im Buche:
Man beginnt mit einer Buche.
Die haut man klein, die haut man kurz,
Von der Spitzel bis zur Wurz.
Dann so trennt man Stamm und Ast
Und fertig ist das Häuslein!
... - fast.
Der Hering
Es war einmal ein Hering,
Der hatte keinen Ehering,
Doch so lang er auch suchte,
Und so arg er auch fluchte,
Konnte er kein Ringlein finden -
Drum konnt' Herr Hering sich nicht binden.
Alter Spruch
Wenn du aus dir verjagst
All Unruh und Getümmel
Dann wirft Sankt Michael
Den Drachen aus dem Himmel
Darfst du bloß nicht drunterstehen
Musst du rasch zur Seite gehen.
Friedrich Schiller
Wenn
Man sich
Eine Woche lang
Mit Schiller beschäftigt
Und wenn man gar nichts anderes tut
Und an gar nichts anderes denkt
Nimmt man in
Sieben Tagen
Vierzehn
Pfund
Ab.
Kleinlich von Kleist
Wer ist glücklich?
Wer kann das?
Wer kann die Wendungen des Schicksals erraten?
Wer kennt die Namen der Magier und ihre Weisheit?
Wer könnte das aussprechen?
Wer versteht das?
Wer versteht mich?
Wer wird nach Jahrtausenden von uns und unserm Ruhme reden?
Wer wollte da gleich sich ängstigen?
Wer?
Ich?
Nein.
Der Käfer Manfred
Es war ein Käfer, der hieß Manfred.
Der krabbelt lustig durchs Gestrüpp
Er krabbelt über Stock und Steine
Das geht sehr schnell, er hat sechs Beine.
Er krabbelt links und geradeaus
Dann mitten in der Spinne Netz
Und da war dann das Krabbeln aus.
Da hängt er nun, der arme Tropf
Fäden kleben ihm am Kopf
Das kennt der Manfred leider nicht
Verheddert sich ganz fürchterlich.
Doch durch Gezucke und Gewimmer
Wird alles leider nur noch schlimmer
Denn sein Zucken und Gezeter
Weckt die alte Spinne Peter
Die krabbelt nun zu ihm hinab
Und Manfred ahnt:
Das Netz heißt Grab!
Der Spinnerich kommt näher, nah ...
Plötzlich ist er vollends da,
Fragt in fieser Seelenruh:
"Ich heiß Peter, wie heißt du?"
So, Manfred, jetzt benutze deinen Charme
Damit die Spinne dich nicht frisst,
So wie du bist, noch jung und warm.
"Ja, ich bin Manfred, Käfer des Herrn,
Und bin gekommen dich zu segnen."
"O", sagt Peter, "nett dir zu begegnen,
Doch ich bin kein Gott'sanbeter,
Ich bin nur die Spinne Peter."
"Dann laß mich doch dein Diener sein,
Ich fange Dir die Fliegen ein,
Auch Vögel, Hasen, Hirsche, Elche,
Du brauchst mir nur zu sagen welche."
"Na gut", sagt da die alte Spinne,
"Das ist ganz in meinem Sinne,
Doch lock mir Käfer in die Falle
Und zwar nicht einen, sondern alle."
Und der Manfred krabbelt los
Durch den Farn und durch das Moos
Und er ging in jedes Land,
Wo er einen Käfer fand.
Er ruft sie alle zu den Waffen,
"Gemeinsam werden wir es schaffen."
Zwölftausend Käfer zählt das Heer
Unser Manfred freut sich sehr,
Sie krabbeln zu der Spinne Netz -
Doch wo ist die Spinne jetzt?
"Hallo", ruft Manfred, "wir sind hier,
Zeig dich, böses Spinnentier."
Doch in Wald und weiter Flur,
Von der Spinne keine Spur.
"Wir ham sie in die Flucht geschlagen,
Die wird es nie nie wieder wagen
Einen nur von uns zu jagen,
Sonst geht's ihr richtig an den Kragen."
Da kommt von oben ein Gekiecher.
Oh Gott, was sind denn das für Viecher?
Zehntausend Spinnen in den Bäumen,
Nicht das Essen zu versäumen.
Seitdem gibt's keine Käfer mehr
Dafür Spinnen umso mehr.
Athen, Nov. '98
Der Kater Manfred
Es war ein Kater, der hieß Manfred.
Und dieser Kater ging spazieren.
Und er tats auf allen Vieren.
Bis hierhin alles ganz normal.
Da kam ein fieses Dackeltier
Wie aus dem Nichts entsteht es hier,
So ein langes strenges Tier
Und stellt sich Manfred in den Weg.
"Weg da, du tumber Katerich,
Kennst denn Du den Dackel nicht?
Ich war als allererster hier,
Diese Straß' gehöret mir."
"Oh, verzeih, Du lange Wurst,
Ich geh zum Brunnen habe Durst.
Will dort meine Pfoten putzen,
muss doch diesen Weg benutzen."
"Der Brunnen, der gehört mir auch,
Ich brauch das Wasser für mein' Bauch.
Du musst den andern Weg benutzen
Und Dich in der Pfütze putzen."
"Ich brauche nur zwei kleine Tröpfchen,
ein' für den Magen, ein' für's Köpfchen.
Lass mich doch zum Wasser gehen.
wirst mich auch nie wieder sehen."
"Nein, nein. Und, ach, ich sah Dich neulich
Dort an dem Baum, es war abscheulich.
Da wetztest Du am Stamm die Krallen,
Das kann mir gar nicht gut gefallen.
Denn Du weißt, der Baum ist mein,
Drum lass die Rinde Rinde sein."
"Ach, und mit den Mäusen, mit den vielen,
Darf ich dann wohl auch nicht spielen?
Sag, darf in der Sonne ich mich räkeln,
Oder würd' auch das Dich ekeln?"
"Genau, genau, Du Neunmalschlau.
Das gehört hier alles mir,
denn ich, ich bin das Dackeltier.
Auch wenn es Dir nicht gut gefällt,
Mir gehört die ganze Welt."
Da fängt der Kater an zu greinen
Und ganz bitterlich zu weinen.
Und weint sich grad die Seele aus,
Da kommt ein Pfiff, dort aus dem Haus.
Und nach dem Pfiff, da kommt ein Mann
Mit sauerrotem Kopf heran:
Des Hundes Herrchen mit dem Strick,
Für Dackelpeters Halsgenick!
"Hund, du sollst vor Deiner Hütte stehen
Und nicht im Park spazierengehen.
Hast Glück, daß ich Dich nicht verdresche,
Jetzt bind' ich Dich an diese Esche."
Der Kater sieht das still mit an
Und beginnt zu lachen dann.
Dann geht die Katz zum Brunnenwasser
Und mit dem Blick zum Katzenhasser
Wäscht sie betulich ihre Pfoten.
Und der Hund?
Der liegt am Knoten.
Athen Nov. 98
Lieb' Mädchen
Lieb' Mädchen, weine, weine bitte nicht
Ich liebe Dich, das geb' ich Dir auch schriftlich
Wir sind für'nander so was wie bestimmt
Gut Kind, ich bin nur etwas schlecht erzogen
Wir sind für'nander so was wie bestimmt
Die Eltern waren keine Pädagogen.
Leichtsinnig nennst Du mich
Ein Herumtreiber sei ich
Ich tränk und schliefe manchmal nicht Zuhause
Doch ich tausch nicht mein Gehirn
Und ich schreib's mir auf die Stirn
So bin ich, und so war ich und, so bleib ich
So bin ich, und so war ich und, so bleib ich
(Übersetzung des griechischen Liedes
"O Epipolaios" von Giannis Kalatzis, 1969)
Traumata am Traualtar
So, wo sind wir denn jetzt wieder hin?
Wie kommen wir da wieder weg?
Gibt’s einen Weg – Hat’s einen Sinn
Wo ich bin - wo wir sind. Wo wir sind?
Wir sind auf Hochzeit in Apolda.
Wird ein toller Abend,
Heute ist Folterabend.
Tschuldigung, Polterabend.
Noch ist's nicht voll da, in Apolda.
Noch sind nur wir da, in Apolda.
Noch ist Bier da, in Apolda.
Apolda: ein Umfeld, wo auffällt, wer umfällt.
Hannes heißt der erste Gast,
Ein Bürgersmann, der ungern verpasst,
Was die Brautfrau Magda da so macht,
In der Nacht, bevor es kracht … Brautnacht …
Schön hier auf der Hochzeitsparty!
Majestätisch prangt ein Fetisch
Auf dem Buffet-Tisch:
Das ist ein Frisch-Fisch!
Tolle Idee – bei dem Budget!
Doch Hannes lehnt am Teetisch.
Hannes kam direktemang von seiner Tante
Gab sich dort bereits die Kante
Und leckt nun leckeres Püree vom Teller.
Hannes schickt geschickte Blicke
Nach der schicken Brautfrau Magda aus.
Die Magda zieht sich geradewegs gerade aus und um
Im Schlupfraum ihrer Mägde und der Zofe vom Hofe.
Was mag die Magda da wohl machen?
Sie schlüpft behend aus heißen weißen Sachen?
Und Sie bricht und bricht und
Sie bricht der Ehe Eid mit Lachen!
Sie stiehlt das Kleid und sich aus dem Hause
Ja, ist denn das Gedicht nun ause?
Nein, die Geschichte geht weiter,
Denn sie nimmt eine Leiter,
Sie klettert aus dem Haus hinab, niemand hält sie,
da bricht die Sprosse, da fällt sie!
Doch sie fällt in ein weich geweiztes Feld
Und gibt den Fersen Fersengeld.
Hannes schaltet automatisch,
Und schnellt im schnellen Auto hinterdrein.
Hannes schaltet automatisch,
So schnell wie er, kann sie nicht sein!
Doch da verreißt er den lieben lila Leder-Lenker,
fährt einen Schlenker zum Henker
und knallt mit Gewalt
direkt in den Wald.
Die Haut an Hannes’ Kopf ist ab.
Magda haut den Kopf ihm ab.
Magda buddelt ihm ein Grab.
Dann haut sie ab, direkt nach Brüssel.
„Brautkleidmarkt für Brüssler Spitzen“.
Da sieht man sie im Brautkleid sitzen,
Doch weil Brüssler gerne witzen,
Bleibt sie dort nicht lange sitzen!
"Komm Mädel, steig mit ein, denn
Gebrauchter Brautkleidverleih,
das kann nicht alles sein,
Zieh dich an, und dann sei mein.“
Und den hat sie dann geheiratet.
Und in Apolda?
Die haben nichts gemerkt.
Die sind immer noch voll da,
In Apolda.
Wind
Atem
Atem der Atem
Menschen der Menschen
Menschen atmende Menschen
Wind hauchender Wind
unsichtbar atmet Erde Erde
der Baum Baum
die Lunge Lunge
Wald atmet unsichtbar Wald
Bäume durch Blätter
durchatmen den Wald
Atem im Blätterbaum atmet
der Wetterwind
blättert im Wetterwind
Wind blättert
in Blättern
blättert der Waldwind
windet der Wind Wind
verfängt sich der Wind
Wind im Wind Wind
Wind Wind
Wind
Anima und Animus
Anima und Animus
fuhren mit dem Linienbus,
hatten sich was zu sagen,
fuhren nach Kopenhagen.
Und mit viel Verdruß Verdruß
stritt Anima mit Animus.
Da nahmen sie eine Säge
und trennten ihre Wege.
Die eine ging nach Kassel,
der andre nach Wiesbaden.
Und nach sieben sieben Jahren,
die nun schon getrennt sie waren,
trafen sie sich dann in Kassel:
"Na, wie war's Baden?
"Wie?"
"Na, wie's Baden war?
"Was?"
"Na, war's doch Baden!?"
"Baden in Kassel? Im heißen Kessel?"
"Wiesbaden in Hessen war!"
"A, wie's Baden war?"
"Ja."
"Schön."
Man kann hier deutlich sehen,
sie konnten sich erneut verstehen,
und wollten nie mehr auseinandergehen.
Der tote Hund (lange nach Baudelaire)
Und als die beiden gehen im Hain,
da spricht sie: "Was mag das dort sein?"
Da liegt etwas im Wiesengrund,
Entstellt und kalt, einstmals ein Hund.
"Was hat der wohl schon gesehen?
Muss so schmählich er vergehen?"
Sich dies fragend schaut sie dann,
ihn genauer einmal an:
Sieht, das zwischen blanken Zähnen
Und auch in den offenen Venen,
Ameisen voller Eifrigkeit
sich tummeln in Glückseligkeit.
Haben doch nun ihre Larven
den wohl wunderschönsten Hafen.
Und stehend vor des Hundes offenen Bauch
Sieht sie zum Manne auf und flüstert:
"Schau, alles liebt sich -
Lieb mich auch."
Traum eines Bildes
Mir könnt
was immer
kommt
Weitere Texte
Dussmann-Kritiker-Preis
Einst ward mir das Glück beschieden, einen Preis zu gewinnen für die Rezension eines Buches über den Dichter Heinrich Kleist. Erste Auflage, erschienen im Piper Verlag München 2004. Hier mein Text:
Heinz Ohff: „Heinrich von Kleist. Ein preussisches Schicksal“
Auf 200 Seiten erzählt Heinz Ohff über Heinrich v. Kleist und betrachtet dessen Leben, Werk und Wirkung. In plauderhaftem Ton fügt der Autor Interessantes und Bekanntes zusammen. Leider gelingt es Ohff nicht, bis zum Untertitel seines Buches vorzustoßen und „ein preussisches Schicksal“ herauszuarbeiten. Obwohl das Buch – laut Klappentext – „mit gewohnter Meisterschaft“ verfaßt ist, könnte es selbst als Einführung zu Kleist nicht überzeugen. Zu ungenau bleibt Ohff in seinen Recherchen. Fußnoten wären mitunter hilfreich. Diese fehlen schon bei Kleists Geburt: Ohff gibt den 19. Oktober 1777 an, obgleich bis heute unklar ist, ob Kleist am 10. oder 18. Oktober geboren wurde. Zu selten geht der Autor ins Detail. Ohff berichtet zwar, wie Kleist einen Räuber von der Kutsche peitschte, erwähnt aber nicht den Brief, in dem Kleist schreibt, daß der Kutscher den Räuber peitschte (an Fr. v. Massow, 1793).
Doch Ohff weiß auf andere Weise zu unterhalten. Fast beiläufig streut er bisher unbekannte Sensationen ein. Demnach starb Schiller nicht 1805, sondern war 1807 (!) noch am Leben, als Kleist einen Verlag in Dresden gründete. Ohff schreibt „Goethe und Schiller finden die gewagte Sache interessant. Auf die Briefe aus Dresden allerdings, die sie um ein paar Beiträge, Gedichte oder Prosa, bitten, reagieren sie nicht. Die beiden Berühmtheiten sind anderweitig wohl weitgehend überlastet“. Ohne zu klären, womit Schiller überlastet war, spielt der Autor den nächsten Trumpf aus: „Das Ehepaar Hardenberg besitzt einiges Unveröffentlichtes ihres im Jahre 1772 erst achtundzwanzigjährig verstorbenen Verwandten, des Dichters Novalis“. Bisher wurde Novalis 1772 geboren. Da blüht uns eine neue Romantikdebatte.
Mitunter verliert Ohff den Faden. Er schreibt kommentarlos: „Es wird nicht das letzte Mal sein, daß die Deutschen einen Krieg verlieren und dadurch einen Anstieg des kulturellen Lebens erfahren.“ Weiter unten entstellt Ohff das Zitat „Heil! Heil! Heil!“ aus „Prinz von Homburg“ (Akt 4,11) mit den undeutlichen Worten „das ging damals noch“. O tempora, o Ohff!
Im letzten Kapitel erwartet den Leser ein lustiges Fehlersuchspiel. Dort ist Kleists Grabstein zu sehen, darauf die Zeile „Er lebte sang und litt“. Ohff aber resümiert: „Ob die Zeile ‚er lebte lang’ für einen so früh Vollendeten passend erscheint, mag dahingestellt bleiben“. Wohin gestellt?
Das Buch lag beim Lesen gut in der Hand, es hat ein Lesebändchen, und auf dem Schutzumschlag sieht man ein Bild, von dem man nicht weiß, ob es Kleist darstellt. Denn wer weiß schon, wie man Kleist darstellt?

Dieter Ruckhaberle - Ein Laubsägeninterview
Abgedruckt im Heft Lazarus-Hospiz-Aktuell, 20. Jahrgang, 2015
Herr Ruckhaberle war Maler und Museumsdirektor (* 20. Juli 1938 in Stuttgart; † 10. Mai 2018 in Berlin). Er baute die Künstlersozialkasse maßgeblich mit auf und brachte u.a. Robert Rauschenberg als erster nach Berlin.
Über viele Monate hinweg übernahm ich Herrn Ruckhaberles Sterbebegleitung im Lazarus-Hospiz in Berlin. Er nutzte die Zeit, um zu malen, ich assistierte ihm dabei. Wir organisierten eine Ausstellung im Hospiz.
Sehr geehrter Herr Ruckhaberle!
Wie alt sind Sie? Seit wann sind Sie hier?
77 Jahre alt, geboren in Stuttgart, aufgewachsen auf dem Dorfe – wunderschönes Bauernweißbrot, dick Butter drauf und Erdbeermarmelade … und im Lazarus Hospiz lebe ich seit Sommer 2015.
Meine Töchter haben ziemlich lange gesucht, und haben schließlich das Lazarus gefunden, wo man gut gepflegt wird – das mag woanders auch sein – aber, das Lazarus hat eine 400m² große Dachterrasse, wo ich malen kann! Das gab den Ausschlag für mich, hierher zu kommen. Aber, bisher habe ich dort nicht gemalt. Meist war es zu heiß. Oder zu kalt. Ich male vom Bett aus. Und ich möchte betonen, wie dankbar ich bin, daß ich hier malen darf.
Was ist das Schönste auf der Welt?
O Gott. Das kann ich nicht sagen. Das sind die Frauen.
Als kleiner Bub auf dem Lande … wir waren so drei Landbuben da aufm Bauernhof. Und da kam in den Ferien so aus der Stadt ein wunderschönes Stadtmädchen: gescheit und hübsch und so. Und da hatten wir so einen Leiterwagen, und da haben wir dann Stöcke dran gebunden und Bänder gekauft für sie und haben das ganze also ausgeschmückt, das schöne Mädchen in die Karre gesteckt und sie dann über die Straße geschleppt. Immer hin und hergefahren mit ihr. Wir waren die Pferde, und da saß die Prinzessin drin.
Und das schönste Bild auf der Welt?
Bathseba von Rembrandt (hängt im Louvre).
Und was ist das Schönste an der Kunst?
Mit einem Schmutzlappen ein gutes Bild malen.
Bitte beschreiben Sie Ihre Bilder …
Ich male aus der Farbe, venezianische Schule. Die Linie wird zurückgedrängt. Das Auge folgt den Farben. Die Farben selber bilden ein räumliches Gefüge.
Seit ich siebzehn bin, malte ich etwa 500 Bilder: 200 in Brasilien und mindestens 250 in Berlin und Stuttgart. In Brasilien hängen acht Bilder, die ich nie verkaufen möchte. Erst recht nicht: „10 Tote Männer“ aus der Serie „Messingstadt/1001 Nacht“. Vielleicht mein bestes Bild. Und es gibt einige Bilder von 1960, die gehören zum Besten was ich je gemalt habe: „Porträt Rolf Forster“ und „Stillleben mit Rückenansicht“. Und einige neue Bilder aus dem Lazarus Hospiz gehören auch zu meinen besten Bildern.
Derzeit zeigen Sie aktuelle Bilder im Lazarus Hospiz. Ein paar Worte zur Ausstellung …
Bisher sind im Hospiz etwa 40 Bilder entstanden. Also, Bilder, die ich hier male, nehmen irgendwas mit, was hier so im Haus ist, Krankentransport, … oder „Der zerlegte Frosch“: Das bin eher ich, eher mein Zustand, schwarzer Grund, Kopf abgeschnitten, Beine abgeschnitten, zerstückeltes Sein.
Für mich ziemlich schön ist das große gelbe Bild mit den vier roten Flecken. Das heißt „Vier mal rot auf gelb“. Das ist abstrakt. Das ist ein Bild, das aus der positiven Stimmung kommt. Also, die eine Schwester hat das sehr gut verstanden, die fand das ganz toll, und die anderen haben nix gesehen. Die eine: „Na, das können meine Kinder ooch!“ Da hab ich gesagt: „Das ist ja ein Kompliment. Das schreib ich mir mal hinter die Ohren. Kinder können toll malen!“
Was ist gute Kunst?
Für gute Kunst sollte ein Künstler drei Katastrophen erlebt haben: Eine wunderschöne Malerkollegin wurde täglich von ihrem Verlobten mit einem wunderbaren Auto in die Hochschule der Künste transportiert und um 16 Uhr wieder abgeholt. Sie kommt eines Tages zu mir: Ich soll ihre Bilder angucken. Sie fragt: „Ist das gut?“ Die Bilder waren genauso schön wie die junge Frau. Ich, Ruckhaberle, sagte: „Wenn Sie nicht wenigstens drei Katastrophen erleben, hat das alles überhaupt keinen Sinn.“ Also, ich will damit sagen: Schöne Bilder zu malen – das mögen ja die meisten gerne: schöne Bilder – alles für die Katz! Schöne Bilder zu malen ist zwar schön, aber meistens für die Katz.
Welche Katastrophen erlebten Sie, Herr Ruckhaberle?
(lachend) Ich glaube, ich habe noch keine Katastrophen erlebt. Ich glaube, dies hier – hier zu sein – ist meine erste …
Was haben Sie im Leben gelernt?
Was ich gelernt habe: Gib kurze Interviews, damit sie nicht drin rumschnibbeln können.
Welchen Ratschlag können Sie jungen Künstlern mit auf den Weg geben?
Lassen Sie die Finger davon.
Herr Ruckhaberle, wir danken für das Interview.
Siehe auch: www.Dieter-Ruckhaberle.de
Schuld macht Sinn - Ein Lehrgang mit Chris Paul
Abgedruckt im Heft Lazarus-Hospiz-Aktuell, 19. Jahrgang, Nummer 3/2014
Frau Chris Paul – Jahrgang 62, eine wundervolle Erscheinung: schwungvoll, herzlich, groß: gefühlte 2 Meter 80. Sie entstammt der Kulturbranche; doch als seinerzeit eine Künstlerin im Museum zu ihr sagte: „Ich arbeite zum Thema Tod – ich arbeite mit geschwärztem Eisen!“ war Chris Paul die verkünstelten Stereotypen leid; sie hängte den Museumsjob an den geschwärzten Nagel und studierte Soziale Verhaltenswissenschaft. Seit 1998 unterhält sie eine Praxis für Trauerbegleitung in Bonn, gründete das Trauerinstitut Deutschland, ist tätig im Vorstand des Vereins „Angehörige um Suizid“, und …, und …, und im Juli besuchte sie endlich Berlin und Lazarus für einen Lehrgang, eine Lesung und einen Vortrag. Vom Lehrgang sei hier kurz berichtet.
Gleich zu Beginn, als sie den Ablauf des Wochenendes umreißt, erteilt sie den 25 Teilnehmern Gedankenfreiheit – wer während der Vorträge und Übungen gedanklich abschweife, möge dies getrost tun; so könnten wertvolle Gedankenverknüpfungen entstehen zwischen dem Vortrag und dem eigenen Leben. Dann kündigt sie ausreichende Pausen an – was wohl alle Lehrer tun – und sie hält es auch ein: was kaum ein Lehrer tut! Das rechne man hoch an; denn damit einer den schweren Inhalt aushält, bedarf es eines Umfelds, in dem keiner umfällt.
Nun aber zur Sache: Schuld. Als erstes streicht sie den Begriff Schuldgefühl. Schuld fühle man nicht, Schuld denke man, sagt Chris Paul, denn Vorraussetzung für Schuld sei der Verstand und nicht das Gefühl (so herrscht bei einem menschlichen IQ unter 70 gesetzlicherseits Schuldunfähigkeit). Die auf Schuldgedanken folgenden Gefühle seien vorrangig Symptome von Streß.
Sodann teilt sie Schuld in zwei Hauptgruppen: Normative Schuld entsteht bei Verstößen gegen Regeln und Paragraphen, Ethik und Moral. Die zweite wichtige Schuldkategorie ist die Instrumentelle Schuld. Diese wird als Werkzeug angewendet, sie nutzt jemandem, sie dient beispielsweise Hinterbliebenden um eine innere Verbindung mit Verstorbenem aufrecht zu erhalten. Für diese Art der Schuld findet Frau Paul das Sinnbild der Krücke. Aber nicht die Schuld an sich ist das Mittel, sondern die Zuweisung von Schuld!
Die erste Frage, die Begleiter sich bei der Begegnung mit Schuld stellen sollten, sei: Wer weist wem welche Schuld zu? Denn haben Beschuldigungen erst einmal begonnen, gibt es oft kein Halten mehr: ein Beschuldigungsmechanismus setzt ein, Schuldvorwürfe strömen in alle Richtungen vor und zurück, kreuz und quer: Frau Paul nennt dies die vagabundierende Schuld.
Damit man dem Wirrwarr aus Beschuldigungen folgen könne, sei es gut, ein Schaubild zu zeichnen: Man benennt die Protagonisten und verbindet sie mit entsprechenden Schuldzuweisungs-Pfeilen. Nun kennzeichnet man die Art der Schuld: normativ oder instrumentell. Und besonders vergesse man sich selbst als Begleiter nicht! Vielleicht wirft man sich selbst bereits Schuld zu? Oder einem anderen? Wenn der Begleiter aktiv teilnimmt an den Schuldverstrickungen, begeht er womöglich einen Fehler. Chris Paul verdeutlicht dies durch einen szenischen Tanz voll Schuld und Klage. Dies sei die Bühne, sagt sie danach, und: „Der Klient tanzt auf der Schuldbühne. Wir nicht!“ Der Begleiter schaue nur zu, er steige keinesfalls auf diese Bühne: er würde die Aufführung zerstören. Aber man solle diese Gesprächsangebote unbedingt annehmen; und unbedingt heißt, tunlichst keine eigene Meinung zu haben: „Begleiter müssen weder jemanden freisprechen noch vergeben – Begleiter begleiten! Wir sind kein weiterer Problemlöser, der am festgezurrten Knoten zerrt!“
Unser Hirn suche zwar stets nach Erklärungen, doch Chris Paul mahnt uns: „Zügeln Sie Ihre allzumenschliche Lust, Erklärungen zu suchen. Wir müssen den Klienten nicht verstehen – und wir fragen nur das, was auch der Klient fragt; er muß die Lösung finden: nicht wir!“ Und so führt sie weiter aus, daß wir Unerklärtes als solches akzeptieren sollten, denn: „Nicht allen schlimmen Geschehnissen liegen Fehler zugrunde.“ Eine Trauernde sagte ihr nach Jahren den erlösenden Satz: „Jetzt kann ich damit leben, daß es keine Antwort gibt!“
Wie können wir Begleiter nun also umgehen mit der Schuld? Frau Paul verdeutlicht dies mit einem Schleiertanz: Viele bunte Tücher voll schöner Erinnerungen wirft sie fort, bis nur ein häßlicher Schleier ihr bleibt, an den klammert sie sich fest und starr, … bis sie die schönen Tücher wieder greift, da lockert sich der scheußliche Schleier und gleitet zu Boden. Trauerbegleiter können also dabei helfen, schöne Gedanken an den Verstorbenen zu entdecken, wiederzuentdecken.
Vieles wäre noch zu berichten … doch sei zum Schluß wenigstens erwähnt, daß alle Kursteilnehmer voll Dankbarkeit Abschied nahmen. Und auf Chris Pauls Frage hin, was der einzelne aus dem Kurs mitnehmen könne, hätte wohl jeder am liebsten Frau Paul eingepackt und mitgenommen. Aber das ging nicht.
Übrigens stellt der Lehrgang „Schuld Macht Sinn“ die Grundstufe eines dreiteiligen Kurses dar: es folgen die „Arbeit mit Selbstbezichtigungen“ sowie „Arbeit mit Normen, Deutungsmöglichkeiten und Vergebung“.
Hoffentlich wird Chris Paul erneut eingeladen nach Berlin mitsamt diesen Modulen. Und dann kann man nur sagen: Wer nicht hingeht hat selber Schuld. Aber Schuldgefühle muß man deshalb nicht haben – mindestens soviel haben wir gelernt.
Vom Umgang mit der Körper-Tambura
Abgedruckt im Heft Lazarus-Hospiz-Aktuell 2017
Was ein Körper ist, mag den meisten Zeitgenossen klar sein – aber was bedeutet Tambura? Das herauszufinden kamen 14 Pflegerinnen und Pfleger zusammen in der musiktherapeutischen Praxis von Frau Dr. Cordula Dietrich. Gemeinsam mit dem Instrumentenbauer Herrn Bernhard Deutz würde sie uns zeigen, was eine Körpertambura ist und was sie kann.
Herr Deutz ist sogar der Erfinder der Körpertambura. Er begann den Unterrichtstag mit einer unterhaltsamen Einführung in die Geschichte der Saiteninstrumente, holte weit aus und landete beim Monochord des Pythagoras, einem einsaitigen Instrument aus der Frühzeit der menschlichen Musikerfahrung, als Musik, Physik und Philosophie dermaleinst die Hände sich reichten zum sittsamen Reigen.
Und bummelig 2500 Jahre später sitzen wir nun wissbegierig auf einem wertvollen Holzfußboden, eine Kuscheldecke unter den Schenkeln und ein unbekanntes Instrument vor Augen. Es sieht so aus wie eine Zither, misst etwa 70 x 30 x 10 cm, besteht aus Bergahorn/Bergfichte, und es ist bespannt mit 28 Stahlsaiten. Für musikalische Profis sei die Stimmung erwähnt: a – d’ – d’ – d, in 7-facher Wiederholung endend auf D. Wie gesagt, da saßen wir nun, und auf ein Zimbelzeichen des Lehrers hin begannen 14 Schüler, vorsichtig zu zupfen und zu spielen …
Und schon klang es wie am Ganges: indisch wirkt diese Musik, absatzlos und ewig, wie die Begleitmelodie zu 1000 und einer Nacht. Der Klang schnarrt sagten einige, er fliegt, meinte ein nächster, und er zuckert die Luft äußerte eine weitere. Wie dem auch sei – bei diesem Instrument kommt es mitnichten bloß auf den Klang an – es ist ja eine Körpertambura: sie wird auf den liegenden Körper des Patienten gelegt, und ein zweiter zupft die Saiten! Es ist somit ein musiktherapeutisches Instrument, ein Streichelinstrument für Körper und Geist, dessen Schwingungen tief in den Menschenkörper dringen. Damit es gut aufliegt und sich anschmiegt, ist der Boden nach innen gewölbt, konkav, wie man sagt – apropos: kennt jemand eine gute Eselsbrücke für die Begriffswelt konkav/konvex? – ich stolpere jedesmal und muß im dicken Duden nachschlagen.
Für uns therapeutische Anwender des Instrumentes stellte es eine durchweg wertvolle Erfahrung dar, den Klang auch im eigenen Körper zu spüren: die anfänglich leichte Vibration, die Harmonie der 1000 Töne, das sanfte Ausbreiten von Schwingung und Klangwellen in der Haut, im Fleisch, in den Knochen – und dann die eigenen Gedanken, die verfliegen zu wundersamen Träumen, getragen vom unendlichen Klang der Körpertambura.
An die herrlichen Klangreisen schlossen die einfühlsamen Dozenten jeweils Gesprächsrunden an; so bekam ein jeder die Möglichkeit von seinem Erleben zu berichten – und speziell davon konnten wiederum alle Kursteilnehmer großartig profitieren – denn 14 Körper erlebten 14 wahrhaft unterschiedliche Ganzkörper-Konzerte:
Während eine Dame auf dem Klangteppich durch die Lüfte flog, fühlte eine weitere sich wie von warmen Wellen durchwogt, eine andere empfand sich weich und zugedeckt, wie von der lieben Mutter Hand; ein Mann spürte nichts, als das Instrument auf seinem Rücken lag, doch ward er gleich darauf durchströmt vom Klang auf Brustkorb und Bauch; noch ein letzter zog sich das Instrument sogar über den Kopf – und spülte sein Gehirn.
All die vielen, durchweg angenehmen Erfahrungen zeigen uns mindestens eines: Der Klang ist gleich – das Körpergefühl ist individuell. Daher gebietet es sich, einem Patienten, dem man mit der Körpertambura begegnen möchte, das Instrument nicht holterdiepolter auf den Brustkorb zu legen, loszuklimpern und nach zehn Minuten zu gehen, sondern einfühlsam und gemeinsam mit dem Patienten sich heranzutasten an die Möglichkeiten der Schwingung und des Klanges der Körpertambura. Und diese sei hiermit jedem empfohlen und buchstäblich ans Herz gelegt von Carsten Schneider, seines Zeichens ehrenamtlicher Helfer im Lazarus-Hospiz.